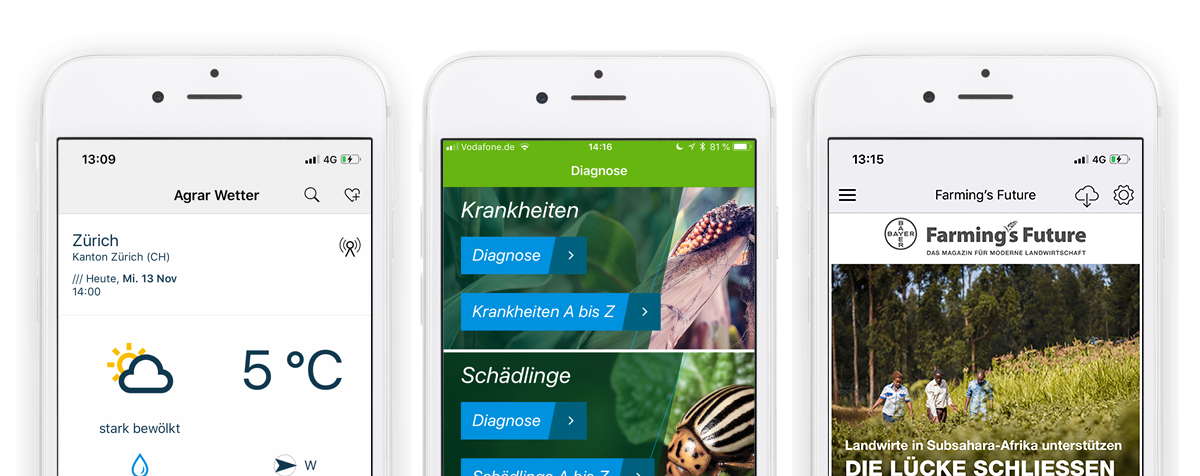-
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
-
G
-
H
-
I
-
K
-
L
-
M
-
N
-
O
-
P
-
R
-
S
-
T
-
V
-
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
-
G
-
H
-
I
-
K
-
L
-
M
-
N
-
O
-
P
-
R
-
S
-
T
-
V
Agrar Magazin / Aktuelles

Guy Parmelin informiert sich bei Marco und Paul Messerli über die Folgen der Initiativen für den Betrieb. (ji)
An den südlichen Ausläufern des Belpberges im Kanton Bern liegt eingebettet zwischen Hügeln der Biohof von Familie Messerli. Auf den insgesamt 27 Hektaren Land ist der Obstbau der Hauptbetriebszweig, das zweite Standbein ist die Eierproduktion. «Die Hühnerhaltung gibt uns Sicherheit», sagt Paul Messerli, der zusammen mit seinem Sohn Marco den Betrieb leitet. Denn der Hauptzweig, der Obstbau, ist als Aussenkultur immer wieder dem Klima und Wetter ausgesetzt. Jetzt im April kämpften Messerlis neun Nächte in Folge gegen den Frost.
Und genau um dieses zweite Standbein machen sich die beiden Bio-Bauern besondere Sorgen, sollte die Trinkwasser-Initiative im kommenden Juni angenommen werden. Das erklärten sie diese Woche Bundespräsident und Agrarminister Guy Parmelin, der sich vor Ort über die Folgen der beiden Agrarinitiativen ein Bild machte.
Konkret geht es Messerlis um das Futter für ihre Tiere. Das Futter besteht einerseits aus Getreide und Mais. «Diesen Teil könnte man in der Schweiz selbst produzieren – wenn man genügend Fläche hätte», sagt Paul Messerli. Rund 35 Prozent des Futters für die Bio-Hühner besteht aus Ölkuchen, hauptsächlich Soja. Gemäss Bio-Suisse-Richtlinien muss dieses aus Europa stammen. In der Schweiz sei Soja klimatisch schwer anzubauen, es funktioniere höchstens bis 550 Meter über Meer und auch dann nur mit viel Arbeit und wenig Ertrag, erklärt Paul Messerli. Das Futter wird deshalb importiert.
«Das reicht nirgends hin»
Die Trinkwasser-Initiative verlangt laut Initiativtext «einen Tierbestand, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann».Rund 82 bis 84 Tonnen Futter fressen Messerlis Hühner während eines Umtriebes, das heisst in den 14 Monaten von der Ein- bis zur Ausstallung. Als Ackerfläche könnten sie von den 27 Hektaren vielleicht 2,5 Hektaren für Weizen nutzen, erklärt Paul Messerli.
«Das reicht nirgends hin», stellt er klar.Entweder könnten sie nach Annahme der Trinkwasser-Initiative die Hühnerhaltung vergessen oder auf ein Minimum runter fahren, vielleicht mit 200 statt den aktuell 2000 Bio-Hennen. «Aber wenn ich sehe, wie viel wir investiert haben, weiss ich, dass das nicht rentabel wäre», so Paul Messerli.
Aus dem Ausland statt aus der Schweiz?
Die Nachfrage nach Bio-Eiern sei sehr gross, betont Marco Messerli. «Und wenn jeder Schweizer Produzent den Tierbestand reduzieren muss, ist das Bedürfnis nach Bio-Eiern noch immer genauso gross», sagt er. Die Eier kämen dann einfach aus dem Ausland. «Das stösst mir sauer aus. Wir haben investiert, haben ein strenges Tierschutzgesetz und Hühner mit Wintergarten und Freilandhaltung», kritisiert Messerli. Und dann sollen künftig die Eier aus dem Ausland kommen, wo auch für Bio-Ware deutlich tiefere Massstäbe herrschen.
Die Initianten der Trinkwasser-Initiative wollen gemäss eigenen Aussagen den regionalen Austausch von Futtermitteln weiter zulassen und präsentieren dazu ein Rechtsgutachten, dass eine solche Interpretation stützen soll.«Man muss die Initiativtexte lesen, nicht interpretieren», sagte Bundespräsident Parmelin klar. Für ihn gilt das nicht nur in Bezug auf die Futtermittel, sondern auch für den Begriff «Pestizid» in der Trinkwasser-Initiative. Denn ob synthetisch oder nicht, steht nicht im Initiativtext. Und auch die Aussagen der Initianten nach Einreichen der Initiativen haben sich mit der Zeit diesbezüglich verändert. Für Parmelin ist klar, dass zum Beispiel auch Kupfer, das im Biolandbau eingesetzt wird, ein Pestizid ist.
Ansprüche der Konsumenten steigen
Pflanzenschutzmittel brauchen auch Messerlis für ihr Bio-Obst. Ihre Bio-Äpfel hielten gut mit konventionellen mit, dafür brauche es aber die Pflanzenschutzmittel, sagt Marco Messerli. Zudem würden die Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten immer höher, erklärt der junge Obstbauer. Das sehe er im Hofladen: Wenn ein Apfel etwas Schorf habe, griffen die Kundinnen und Kunden zu einem anderen. «Aber dennoch wollen uns viele Konsumentinnen und Konsumenten sagten, wie wir die Äpfel produzieren sollen», macht Messerli auf das Paradox aufmerksam.
An Grossverteiler liefern Messerlis nicht mehr. «Die Ansprüche wurden immer höher, die Preise tiefer», sagt Marco Messerli dazu. Messerlis investierten deshalb in ein neues Lager und in eine Sortieranlage. Das Obst geht in die eigenen Hofläden, an Marktfahrer in Thun und Bern sowie an kleinere Bioläden.
Seit der Bio-Umstellung 2013 habe die Familie gut 3 Millionen Franken investiert, sagt Marco Messerli. «Und das bedeutet für mich auch, dass ich diesen Beruf weiterleben und -führen werde. Wenn nötig, ohne Direktzahlungen.» Aber die Initiativen würden den Betrieb massiv einschränken.
Die Leidenschaft fürs den Betrieb ist nach wie vor gross bei den Messerlis: «Die Selbstvermarktung von rund 90 Tonnen Äpfeln ist aufwändig. Aber wir sehen dabei eine stärkere Dankbarkeit gegenüber dem Produkt», sagt Paul Messerli. «Deshalb halten wir daran fest – für uns stimmt das so.»
Mehr Spritzdurchgänge nötig
Vor Jahrzehnten sei es einfach gewesen, erzählt Paul Messerli. Dazumal sei man einmal mit einem Spritzmittel durchgefahren und dann habe man ein halbes Jahr Ruhe gehabt. Gut sei das natürlich nicht gewesen. Heute sei alles deutlich umweltverträglicher, aber man müsse deshalb öfter spritzen. «Wenn ich jetzt Tonerde gegen Schorf einsetze, ist nach 15 bis 20 Millimeter Regen der äusserliche Schutz weggeschwemmt und wir haben 6 bis 8 Stunden Zeit, einen neuen Schutz zu geben», erklärt der Obstbauer. Im Gegensatz zum konventionellen Landbau könne man bei Bio die natürlichen Mittel zudem nicht kombinieren. «Da müssen wir für dasselbe zwei- bis dreimal fahren», sagt er.
Mit der Konsequenz, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sehen, dass der Bauer öfter spritzt. «Es ist deshalb in unserem Interesse, die Kundinnen und Kunden zu informieren, was wir tun und wieso wir es tun», sagt er. «Und wir hoffen, dass die Medien helfen, dies zu erklären», ergänzt Marco Messerli.